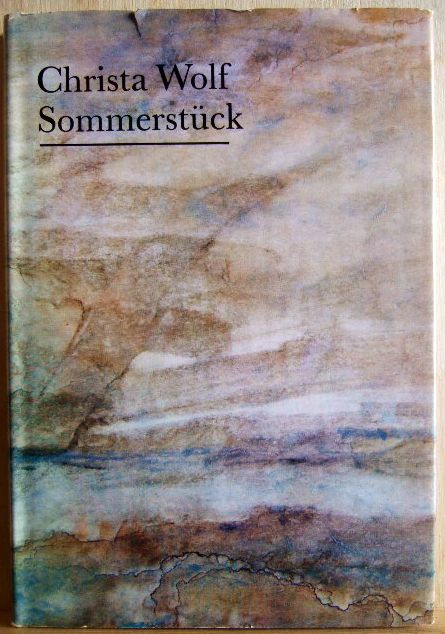„Man versteht nicht, was man nicht mit anderen teilt.“ (Christa Wolf)
20. Dezember 2011 von Thomas Hartung
Es waren keine guten Tage, die letzten; Vaclav Havels Gehen beendet sie jetzt hoffentlich. „Wie sind wir so geworden, wie wir heute sind? Eine der Antworten wäre eine Liste mit Buchtiteln“, fragt und antwortet die Autorin der „Kindheitsmuster“ in denselben. Stimmt. Eine andere wäre eine Liste mit Filmen. Mir ist, als hätte ohne Ablösung in Sichtweite eine gleich zweifache Schildwacht für mich und meine Generation den Posten verlassen. Denn zwei, die meine Listen maßgeblich prägten, sind nicht mehr.
Der eine prägte meine Kindheit: Zdenek Miler. Oder besser: sein Maulwurf (denn von wem er gezeichnet war, erfuhr ich viel später). Der erste Film – jene legendäre maulwürfische Hosenproduktion mit dem Krebs als Zuschneider – lief, wie die meisten anderen danach auch, Sonntagnachmittag als „Abenteuer im Märchenland“, mit Meister Nadelöhr, Pitti und Schnatterinchen. Drei Dinge waren es, die mich faszinierten: die großen Hosentaschen (Schatzkammern auch meiner Kindheit), die großen Augen samt dem O-Mund (so staune ich auch immer, noch jetzt) und die vielen Tierfreunde, denen er ebenso half wie sie ihm. Rakete, Schneemann, Großstadt… – der Maulwurf erinnert mich bis heute daran, dass unser Wissen mit unserer Sehnsucht nie übereinstimmt. Diese Projektion machte ihn so liebenswert – er erlebte jene Realität, aus der ich nie wegwollte.

Der Meister und seine Schöpfung. Quelle: http://www.welt.de/multimedia/archive/01518/ak_maulwurf_DW_Bay_1518281p.jpg
Die andere – eben Christa Wolf – prägte mich vor allem als Germanistik-Student, aber eigentlich bis heute… Ingeborg Harms hat in ihrem Nachruf – unbewusst – das Gespinst benannt, das für mich zwischen Wolf und Miller besteht: „Literatur war für sie der Passierschein in eine Möglichkeitswelt: Christa Wolf suchte zeitlebens den Anschluss an das, was sie für wahr hielt.“ Mit ihr verschwindet eine Welt: die, in der Bücher noch etwas galten. Die, in der Autoren ihren Lesern mehr waren als nur Verfasser von Texten. Und die, in der deren Figuren weniger durch ihr Aussehen, ihre Hobbys, ihren Tonfall bedeutsam wurden. Es war nicht wichtig, wie eine Figur etwas sagte, sondern was sie sagte, las ich jüngst. Es war nicht wichtig, wer es sagte, sondern dass es gesagt wurde.
Noch einmal blättern in ihren Büchern, die ich „verzierte“ mit vielen kleinen Eselsohren, Anmerkungen, Unterstreichungen; die Passagen abrufen, die ich auswendig wusste, weil sie einen Weg wiesen, wie – wenn auch mühsam – entfremdeten Verhältnissen Sinn abzuringen ist; die Bilder, mit denen ich mir und anderen Mut machte – selbst wenn wir von Sinn- und Mutlosigkeit sprachen. Es sind diese Fetzen, die Herkunft und Hoffnung des einen kriegsgeborenen Halbdeutschland erfahrbarer werden ließen als aller Unterricht. Weil, wie Arno Widmann treffend formulierte, die Wahrheit nicht etwas ist, was wir irgendwo abholen und vertreten können, sondern dass etwas durch uns hindurch gegangen sein muss, um wahr zu sein.
Der emotionalste und zugleich profundeste Nachruf stammt aus der Feder einer Kritikerin, von der ich ihn am wenigsten erwartete: Iris Radisch. „Aber im Grunde hat sie alles, die Politik, die DDR, das Leben, romantisch gesehen“, schrieb sie in der ZEIT. Ja, das war einer ihrer Grundzüge beim „Sich-Heranarbeiten an die innere Grenzlinie“, wie Wolf ihr Schreiben nannte. Eine romantisch erweiterte Politikauffassung, die das Persönliche öffentlich und das Öffentliche persönlich verstehen möchte. Die Aufklärerin Christa Wolf war eine deutsche Romantikerin in dem Sinn, dass sie im irreparablen Dissens zum Status quo der Welt wohnte. Ihr Hauptthema war das Leiden an einer Gesellschaft, die weit hinter den Entwürfen einer besseren Welt zurückbleibt. „Freitag“-Herausgeberin Daniela Dahn (die mit ihrem „Coitus interruptus“ das für mich immer noch gültigste Bild der Wiedervereinigung entwarf) brachte es auf den Punkt: „Stellvertretend für viele in Ost und auch in West, die an der Utopie einer gerechten Gesellschaft festhielten, bleibt Christa Wolf auch im vereinten Land Dissidentin.“ „Ich habe dieses Land geliebt“, schrieb Wolf 1993 an Günter Grass. „Dass es am Ende war, wusste ich, weil es die besten Leute nicht mehr integrieren konnte, weil es Menschenopfer forderte.“ Das mag man sich heute öfter durch den Kopf gehen lassen…
Der zweite Grundzug, untrennbar mit dem ersten verwoben: ihre Sprache, die fast unisono von allen Porträtierenden und Erinnernden gewürdigt wird. Radisch spricht von einer unverwechselbaren Stimme, einem in die Magengrube fahrenden, immer ein bisschen wehen Moll-Ton. Und Christoph Dieckmann gar von einem Christa-Wolf-Sound: „…dieser grübelnde, rauschende Bewusstseinsstrom der Selbst- und Welterkundung…“ Ihr Schreiben war kein Behaupten, sondern ein Suchen, Fragen, Sichvorantasten im scheinbar Ungewissen. Oder zumindest die authentische Inszenierung einer solchen bedingungslosen Offenheit, wie Radisch mutmasst. Ein so dichtes, dabei rhythmisches Schreiben, das andere Prosa einfach nur platt wirken lässt, hat auch etwas Sperriges: der Leser wird gezwungen, genau zu lesen. Sich einzulassen auf den Gedanken- und Gefühlskosmos, in den er da eintaucht. Dieser Moll-Ton übrigens, dieser „keusche pfarrhäusliche Sehnsuchtston“ (Radisch) verweist auf einen sekundären Aspekt nicht nur ihres Schreibens. Das Bewusstsein, aus vielerlei Mangelerfahrung heraus sich zu artikulieren, kann Sperriges auch schmerzen lassen. „Preußisch dosiert und beherrscht, durchwaltet Christa Wolfs Werk ein schmerzlich sentimentalischer Zug. Ohne ihn ist keine Liebe, doch er muss erlitten werden, sonst würde er Kitsch“, meint Dieckmann. Wolf selbst spricht von einem „nie sich abnutzenden Schuldgefühl, das uns, die wir den Mangel kennen, einen jeden Genuss durchdringt und erhöht.“ Hans-Eckart Wenzel behauptet gar, sie akzeptiere „eine Unfreiheit im weitesten Sinne, weil sie ihre Verankerungen in die Welt nicht kappte. Um keiner Mode, um keiner Macht willen.“ Vielleicht sind es aber solche Mangel- und Unfreiheitserfahrungen, dieses Wissen um die Einmaligkeit jedweden Genusses, die in einer Welt, in der alles „gleichgültig, weil gleich gültig“ sei (Peter Turrini), jene Art von Reflexivität zeitigt, die heutigen kurzlebigen Erfolgsautoren, und nicht nur ihnen, völlig abgeht.

Cnrista Wolf auf der Leipziger Buchmesse 2004. Foto: Peter Endig. Quelle: http://www.lima.diplo.de/contentblob/2192878/Galeriebild_gross/356378/Christa_Wolf_2.jpg
Der dritte Grundzug ist kein textimmanenter, sondern hat etwas mit Christa Wolfs vor allem rechtselbischer Rezeption zu tun. Als „transzendierende Lebensmitschrift“ sah Radisch die Texte, die in diesem „Zustand zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit“ balancierten, ein Jahrhundertgefühl von transzendentaler Obdachlosigkeit trafen. Wer schon 1979 „Kein Ort. Nirgends“ titelte und darin Sätze schrieb wie „Wo du nicht bist, da ist das Glück“, konnte Unbehaustheit knapper nicht artikulieren. Woran noch glauben? Woraufhin leben? Viele DDR-Leser projizierten in Christa Wolfs Werk und ihre Persönlichkeit einen Mut, den sie sich erhofften und oft selbst nicht aufbrachten: die Erde bewohnbarer zu machen. Ich stimme Radisch völlig zu, die meint: „Moderne Literatur sorgt sich um den Einzelnen, mit dessen Einsamkeit sie sich abgefunden hat; die Literatur, für die Christa Wolf zu Recht berühmt ist, sehnt sich nach der Überwindung seiner Einsamkeit. Sie hat, ob es gefällt oder nicht, eine höhere Herzfrequenz und einen weiteren Horizont.“ Ähnlich Dieckmann: „Der verunfallte Staat wurde zum menschlichen Kontinent. Global war auch Christa Wolfs moralischer Horizont, ihr universales Fragen.“ Nebenbei: Dieckmann (der für die ZEIT schreibt) erklärte, und ich reihe mich da gern mit ein:
„Diese Unterscheidung von Historie und Einzelgeschick wurde mir zur goldenen Regel des Reporterberufs: Vermittle zwischen Großgeschichte und Biografie. Füge beiden das wechselseitig Fehlende hinzu. Lass die Spannungen gelten. In den Brüchen nisten die Geschichten.“
Aber genau diese ungebundenen Horizonte scheinen heute angesichts televisionärer Krawallformate, historischer Unbildung und realpolitischer Simplifizierungsdramaturgie ein Problem zu sein, anders sind dummdreiste Erbärmlichkeiten wie dieser Leserkommentar in der „Welt“ kaum erklärbar: „Die Frau hat drei Jahre für die Stasi gearbeitet. Eine Stunde ist schon ein Verbrechen an seinen Mitbürgern. Die Bücher, welche grösstenteils von Ex-Stasileuten und Parteigenossen gekauft wurden, sind hohles Geschwurbel und man darf fragen, was darin intellektuell oder nur lesenswert ist.“ Dass Nobelpreisträger Günter Grass in einer leidenschaftlichen Rede inzwischen eine Entschuldigung von Wolfs westdeutschen Kritikern gefordert und führenden deutschen Zeitungen vorgeworfen hat, nach dem Fall der Mauer eine „öffentliche Hinrichtung“ an der Autorin zelebriert zu haben, nehmen solche Kleingeister offenbar gar nicht wahr. Und erinnern wir uns: als Ernst Jünger („In Stahlgewittern“) starb, waren neben dem damaligen MP Erwin Teufel auch Regierungsvertreter und fünf Bundeswehrgeneräle bei der Beisetzung dabei. Hier waren es nur Ost-Politiker und gesamtdeutsche Kollegen. Vielleicht sollte man die Horizontfrage weiter fassen…

Trauerzug in Berlin. Quelle: http://www.bz-berlin.de/multimedia/archive/00334/christa-wolf3_3346516.jpg
„DDR-Literatur muss auch ohne DDR funktionieren, sonst ist sie keine Literatur“, postulierte Evelyn Finger, noch drastischer Egon Bahr: „Die Spaltung darf nicht über den Tod hinausreichen.“ Für mich gehören vor allem zwei Texte zum Besten, was deutsche Literatur (nicht DDR-Literatur) nach 1945 hervorbrachte. Neben der schon genannten romantischen Novelle „Kein Ort. Nirgends“ ist es ein Prosastück, das Wolf parallel dazu begann, aber erst „in der Windstille zwischen zwei Epochen“ 1989 freigab: „Sommerstück“ (Fritz J. Raddatz forderte damals in der ZEIT den Nobelpreis für die Autorin, den sie – nach Hertha Müllers Ehrung – absehbar nicht mehr erhalten würde).
Eine faszinierende Endzeitnovelle, ein Abschiedsspiel mit autobiographischen Zügen, eine Midlife-Party der verlorenen Träume. Porträtiert werden anspruchsvolle Selbstverwirklicher, die einst dachten, ihnen stünde mehr Welt als je zuvor offen, und nun desillusioniert an ihren verbliebenen Sehnsüchten laborieren. Die entscheidenden Sätze sind bis heute:
„Ganz deutlich, bedrängend sogar, spürten sie doch bei aller Lebensfülle einen Vorrat in sich, der niemals angefordert wurde, ein Zuviel an Fähigkeiten und Eigenschaften, die sie für nützlich und brauchbar hielten, die eine Vergangenheit und, so hofften sie immer noch, eine Zukunft hatten, aber keine Gegenwart. Was eine Zeiterscheinung war, bezogen sie noch auf sich. Sie waren es, die nicht gebraucht wurden.“
Wir – ein gutes Dutzend Magdeburger Germanistikabsolventen mit Kind und Kegel – lasen uns während des Augusts 1989 wechselseitig daraus vor. Das Diplom lag ein Jahr zurück; eigentlich hätten wir angekommen sein müssen, uns gebraucht fühlen (dass wir Monate danach nochmals aufbrechen sollten, nahmen wir in dieser Schärfe noch nicht wahr). Wir hatten unser Sommercamp in der tiefsten Thüringer Rhön bezogen, lebten wie eine insuläre Gemeinschaft und wollten gegen die ungelebten Träume anleben: indem wir Wolfs Idee vom „Malvenfest“ nachspielten. Es war alles da: Männer und Frauen, Brot und Wein, Grillen und Mond. Aber es steht bis heute aus, das Fest. Die Malven, nur die Malven, die haben wir nicht gefunden am Weg.