Freiheit statt Menschheit
2. September 2025 von Thomas Hartung
Jüngst feierte die Idee der „Menschheit“ als universalistische Utopie mal wieder fröhliche Urständ. Das ist ahistorisch, pseudoharmonisch und kulturignorant. Eine Replik.
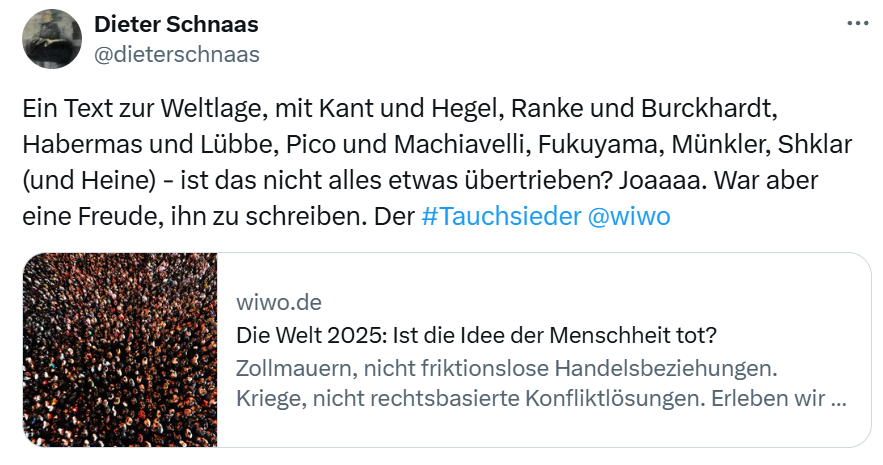
Die Idee einer moralisch geeinten „Menschheit“, die als globales politisches Subjekt mit universellen Werten, einer gemeinsamen Ethik und einer weltumspannenden Stimme fungiert, gehört zu den letzten metaphysischen Großmythen der säkularen Moderne. Ihre Verkünder – von Philosophen über Politiker und Denker wie Herfried Münkler und Judith Shklar bis hin zu Journalisten wie Dieter Schnaas Anfang August in der WirtschaftsWoche („Ist die Idee der Menschheit tot?“) – bedienen sich hochtrabender Begriffe wie „Menschenwürde“, „Weltbürgertum“ oder „Zivilisationsökumene“. Diese Konzepte suggerieren eine harmonische Einheit, die jenseits historischer, kultureller oder politischer Differenzen existiert. Sie klingen nach moralischer Vollendung, entpuppen sich jedoch bei näherer Betrachtung als ideologisch aufgeladener Utopismus, der die Realität des Politischen und die Vielfalt der Geschichte verkennt.
Schnaas beruft sich in seinem Artikel auf Herfried Münklers Konzept der „Weltinnenpolitik“, das eine globale Ordnung unter universellen Werten wie Menschenrechten und Demokratie fordert. Münkler argumentiert, dass die zunehmende Vernetzung durch Handel, Kommunikation und Migration eine globale Binnenpolitik erfordere, in der nationale Grenzen und kulturelle Differenzen zugunsten eines einheitlichen Rahmens zurücktreten. In seinem Buch „Welt in Aufruhr“ (2019) beschreibt er diese Ordnung als Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung, die nationale Souveränität obsolet mache. Die „Weltinnenpolitik“ soll Konflikte durch globale Governance und Konsens lösen, wobei Institutionen wie die UNO oder die WTO als Schiedsrichter fungieren. Doch diese Vorstellung ignoriert die existenzielle Natur des Politischen, wie Carl Schmitt sie in „Der Begriff des Politischen“ (1932) beschreibt.
Schmitt definiert das Politische durch die Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Diese Unterscheidung ist nicht moralisch, wirtschaftlich oder juristisch, sondern existenziell: Sie betrifft das Überleben und die Selbstbehauptung von Gemeinschaften. Eine „Menschheit“ als politisches Subjekt existiert nicht, da sie keine konkrete Gemeinschaft bildet, die sich gegen andere abgrenzen kann. Schmitt warnt: „Wer Menschheit sagt, will betrügen.“ Der Begriff wird instrumentalisiert, um politische Gegner zu delegitimieren. In Münklers „Weltinnenpolitik“ wird dieser Mechanismus offensichtlich: Staaten, die sich einer westlich geprägten Ordnung widersetzen – etwa Russland, China oder der Iran –, werden als „regressiv“ oder „autoritär“ stigmatisiert. Sie gelten nicht als legitime Gegner mit eigenen Ordnungsvorstellungen, sondern als moralische Defizite, die es zu „erziehen“ gilt.
„Menschheit vor der Spaltung retten“
Dies zeigt sich etwa in Annalena Baerbocks Rede vor der UN-Generalversammlung 2023, in der sie die „Spaltung der Menschheit“ als Pathologie brandmarkt, die es zu überwinden gelte. Sie sprach davon, „die Menschheit vor der Spaltung retten“ zu müssen, als wäre Spaltung nicht der Normalzustand des Politischen, sondern ein zu heilender Defekt. Zudem fabulierte sie von einer „regelbasierten internationalen Ordnung“, die auf „unveräußerlichen Menschenrechten“ gründe. Doch wie Schmitt betont, ist das Politische durch Antagonismus definiert. Münklers „Weltinnenpolitik“ ist somit kein Weg zur Harmonie, sondern ein hegemoniales Projekt, das Differenz unterdrückt und politischen Pluralismus negiert.
Diese Kritik lässt sich durch ein konkretes Beispiel illustrieren: Die Interventionen des Westens im Nahen Osten, etwa im Irak oder in Libyen, wurden oft im Namen universaler Werte wie Demokratie und Menschenrechte gerechtfertigt. Doch die Ergebnisse – Chaos, Machtvakuum, Bürgerkriege – zeigen, dass die Idee einer globalen Ordnung, die auf westlichen Prinzipien basiert, die kulturellen und historischen Realitäten anderer Regionen ignoriert. Die „Weltinnenpolitik“ ist kein universeller Konsens, sondern ein westliches Konstrukt, das andere Ordnungen delegitimiert und so neue Konflikte schafft.
Ein weiteres Konzept, das Schnaas aufgreift, ist die „Zivilisationsökumene“, inspiriert von Judith Shklar. In ihrem Werk „Ordinary Vices“ (1984) betont Shklar die Vermeidung von Grausamkeit als zentrales Prinzip einer liberalen Ordnung. Die „Zivilisationsökumene“ soll eine globale Gemeinschaft beschreiben, in der unterschiedliche Kulturen unter dem Dach gemeinsamer Werte wie Menschenrechte und Toleranz koexistieren. Schnaas sieht darin ein Ideal, das die „Menschheit“ retten könne, indem es kulturelle Differenzen überbrückt. Doch diese Vorstellung ist historisch und anthropologisch naiv, wie Oswald Spengler im „Untergang des Abendlandes“ (1918–1922) zeigt.
Spengler betrachtet Kulturen als eigenständige Organismen, die aus einer jeweils einzigartigen „Seele“ leben. Jede Kultur hat ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Werte, ihre eigene Dynamik – eine Vereinigung zu einer „Menschheit“ ist unmöglich, da Kulturen nicht in einem universalen Ganzen aufgehen können. In seiner Analyse schildert Spengler keine lineare Entwicklung der Menschheit, sondern eine Parallelgeschichte von Kulturen, die sich niemals zu einem einheitlichen Ganzen vereinigen lassen. Die „Zivilisationsökumene“ ist für Spengler Ausdruck westlicher Dekadenz: In ihrer zivilisatorischen Endphase neigt die abendländische Kultur dazu, ihre Werte als universell zu verabsolutieren und anderen aufzuzwingen.
Konstrukt statt Ordnung
Shklars Fokus auf die Vermeidung von Grausamkeit mag moralisch ansprechend sein, doch er ignoriert die Realität kultureller Differenz. Was in einer Kultur als „Grausamkeit“ gilt, ist in einer anderen möglicherweise Teil einer legitimen Ordnung. Beispielsweise wird die Todesstrafe in westlichen Gesellschaften oft als grausam verurteilt, während sie in anderen Kulturen als notwendiger Bestandteil der Gerechtigkeit angesehen wird. Die „Zivilisationsökumene“ wird so zu einem Werkzeug westlicher Hegemonie, das kulturelle Eigenheiten nivelliert, anstatt sie anzuerkennen.
Ein konkretes Beispiel ist Emmanuel Macrons Versuch, Frankreich als Mittler universeller Werte zu stilisieren. In seiner Rede vor der UNO 2022 betonte er die universelle Gültigkeit von Freiheit und Menschenrechten, während er in Afrika auf postkoloniale Skepsis stößt. Afrikanische Staaten sehen in solchen Proklamationen oft eine Fortsetzung kolonialer Arroganz – und nicht zu Unrecht. Die „Zivilisationsökumene“ ist keine neutrale Ordnung, sondern ein westliches Konstrukt, das andere Kulturen unter seine Maßstäbe zwingt. Diese Haltung ist Ausdruck eines moralischen Imperialismus, der andere Kulturen als defizitär betrachtet.
Carl Schmitts Warnung, dass die „Menschheit“ ein Werkzeug ist, „mit dem man höchstens den Feind töten will“, findet hier ihre Bestätigung. Die liberalen Imperien des Westens haben dies perfektioniert: Sie intervenieren, sanktionieren und delegitimieren im Namen universeller Werte, während sie ihre eigenen Interessen als allgemeingültig stilisieren. Die „Menschheit“ wird so zur ideologischen Keule gegen jede politische Alternative – ein säkulares Heilsinstrument mit totalitärem Potenzial. Selbst Xi Jinpings „Schicksalsgemeinschaft der Menschheit“, die Schnaas als Gegenentwurf nennt, ist kein echter Universalismus, sondern ein chinesisch geprägter Partikularismus im Gewand des Allgemeinen. Xi spricht zwar von globaler Kooperation, doch seine Vision ist durch die Interessen Chinas geprägt, etwa durch die Belt-and-Road-Initiative, die wirtschaftliche und geopolitische Dominanz sichert.
Schnaas suggeriert, dass die Idee der „Menschheit“ durch die Krise globaler Institutionen wie der UNO gefährdet sei. Er verweist auf die Schwäche der UNO, die als Hüterin globaler Werte agieren solle, aber zunehmend an Einfluss verliere. Doch diese Krise zeigt nicht den Tod der Menschheit, sondern ihre historische Leere. Spengler betont, dass es keine lineare Geschichte der Menschheit gibt, sondern nur die Parallelgeschichte von Kulturen. Der Fortschrittsglaube, der die „Menschheit“ als Ziel der Geschichte sieht, ist ein Produkt westlicher Hybris. In Der Untergang des Abendlandes beschreibt Spengler, wie die abendländische Kultur in ihrer zivilisatorischen Phase ihre Werte universalisiert und andere Kulturen unterwirft. Die UNO, die Schnaas als Symbol der „Menschheit“ darstellt, ist kein Ausdruck einer universellen Ordnung, sondern ein Konsensverwalter ohne Durchsetzungskraft. Ihre Resolutionen bleiben oft wirkungslos, wie etwa im syrischen Bürgerkrieg oder im Konflikt um die Ukraine.
Der Weltbürger als Heimatloser
Die multipolare Weltordnung, die sich nach dem Scheitern des amerikanischen Hegemoniemodells formiert, unterstreicht diese Kritik. Die BRICS-Staaten – Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika – sind keine Wertegemeinschaft, sondern eine Zweckallianz geopolitischer Interessen. Sie vereint nicht die Idee einer „Menschheit“, sondern der Wunsch nach Eigenständigkeit gegenüber westlicher Dominanz. Russland setzt auf nationale Souveränität, China auf wirtschaftliche Expansion, Indien auf kulturelle Selbstbehauptung – eine gemeinsame „Menschheit“ ist hier nicht erkennbar.
Kulturelle Selbstbehauptung, nationale Identitäten und historische Traumata prägen die Welt stärker als abstrakte Konzepte. Ein Beispiel ist die Rückkehr religiöser Ordnungsmuster im Nahen Osten, wo der Islamismus nicht als universelle Ideologie, sondern als kulturelle Selbstbehauptung gegenüber westlicher Säkularisierung agiert. Ebenso zeigt die Skepsis vieler afrikanischer Staaten gegenüber westlichen Menschenrechtskonzepten, dass historische Traumata wie Kolonialismus die Wahrnehmung universeller Werte prägen.
Hannah Arendt untermauert diese Kritik aus anthropologischer Perspektive. In „Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft“ (1951) betont sie, dass Rechte nur in einer konkreten politischen Gemeinschaft wirksam sind. Der „Weltbürger“, den Schnaas und Münkler als Ideal feiern, ist in Wahrheit ein heimatloser Mensch ohne Substanz. Ohne Zugehörigkeit zu einer konkreten Gemeinschaft – sei es Familie, Volk oder Staat – verliert der Mensch seine politische Handlungsfähigkeit. Arendt verweist auf die Lage der Staatenlosen nach dem Zweiten Weltkrieg, die trotz angeblich universeller Menschenrechte keine Rechte hatten, weil sie keiner politischen Gemeinschaft angehörten. Die „Menschheit“ als abstraktes Konstrukt kann diese Zugehörigkeit nicht ersetzen. Wer nationale Ordnungen zugunsten einer globalen Utopie schwächt, zerstört letztlich den Raum, in dem Rechte überhaupt realisiert werden können.
Schnaas betont die moralische Kraft der „Menschheit“, die durch universelle Prinzipien wie Menschenrechte getragen werde. Er zitiert dazu Shklar, die Grausamkeit als universelles Übel verurteilt, das es zu überwinden gelte. Doch dieser moralische Rigorismus ist gefährlich, wie Ortega y Gasset in „Der Aufstand der Massen“ (1930) zeigt. „Die Menschheit ist ein leerer Name, wenn er nicht von den Völkern her mit Sinn gefüllt wird“, schreibt er. Der Mensch lebt nicht in abstrakten Konstrukten, sondern in konkreten Gemeinschaften, die durch Sprache, Glaube und Geschichte geprägt sind. Die Idee der „Menschheit“ ignoriert diese Verwurzelung und fordert eine Gleichmacherei, die kulturelle Identitäten und politische Differenzen auslöscht.
Allianz statt Einheit
Ein historisches Beispiel ist die NATO-Intervention in Jugoslawien 1999, die im Namen der „Menschheit“ und der Verhinderung von Völkermord durchgeführt wurde. Doch die Folgen – Destabilisierung, ethnische Spannungen, langfristige Konflikte – zeigen, dass solche Eingriffe oft weniger moralisch als machtpolitisch motiviert sind. Die „Menschheit“ dient hier als Rechtfertigung für westliche Interessen, während die betroffenen Regionen in Chaos versinken.
Religiöse Ordnungsmuster gewinnen weltweit an Bedeutung, etwa im islamischen Raum, wo der Islamismus als Reaktion auf westliche Säkularisierung agiert. Nationale Identitäten und historische Traumata prägen die Politik stärker als globale Utopien. In Afrika führt der postkoloniale Widerstand gegen westliche Werte zu einer Rückbesinnung auf eigene Traditionen. Selbst in Europa zeigt der Aufstieg populistischer Bewegungen, dass die Idee einer universalen „Menschheit“ an Strahlkraft verliert. Die UNO, die Schnaas als Symbol globaler Einheit sieht, ist zum Konsensverwalter ohne Durchsetzungskraft verkommen. Ihre Resolutionen, etwa zur Klimakrise oder zu Menschenrechten, bleiben oft symbolisch, weil sie die realen Machtverhältnisse ignorieren.
Fjodor Dostojewski fasst dies in „Die Dämonen“ (1872) treffend zusammen: „Lieben kann man nur das Konkrete. Die Menschheit aber ist ein Phantom.“ Der Mensch lebt in Gemeinschaften, nicht in einer abstrakten „Menschheit“. Wer das Politische will, muss das Allgemeine aufgeben. Schnaas’ Versuch, die „Menschheit“ als utopisches Ideal zu retten, ist ein letzter Akt westlichen Fortschrittsglaubens. Dieser Glaube ist eine Illusion, die die Realität des Politischen und die Vielfalt der Kulturen negiert. Die multipolare Weltordnung, die Rückkehr kultureller Selbstbehauptung und der Verlust westlicher Hegemonie zeigen, dass die „Menschheit“ keine Zukunft hat.
Wer sie beschwört, riskiert nicht nur die Zerstörung politischer Pluralität, sondern auch die kulturelle Substanz, die den Menschen erst menschlich macht. Denn die Welt bewegt sich in eine andere Richtung: hin zu einer Anerkennung von Differenz, Pluralität und kultureller Eigenheit. Die „Menschheit“ war nie lebendig – sie ist ein intellektuelles Konstrukt, geboren aus westlichem Fortschrittsglauben, genährt von moralischem Rigorismus, getragen von politischen Interessen. Wer sie beschwört, handelt nicht fortschrittlich, sondern gefährlich: „Menschheit“ ist kein Ziel, sondern das Ende.